Überbrückungsrente für Arbeitslose ab 60 im Ständerat umstritten
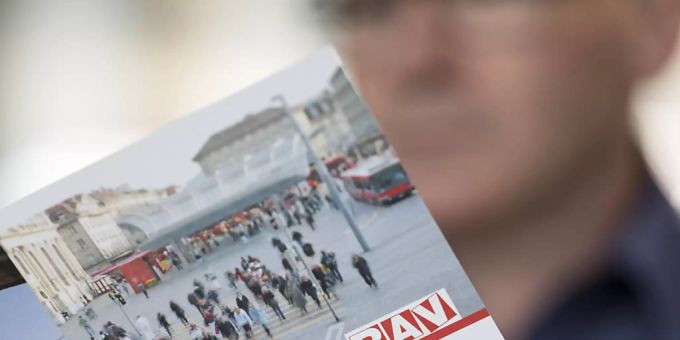
Das Wichtigste in Kürze
- Die neue Sozialleistung ist Teil eines Massnahmenpakets für ältere Arbeitslose.
Der Bundesrat will damit nicht zuletzt die Akzeptanz der Personenfreizügigkeit erhöhen. Sozialminister Alain Berset sprach bei der Präsentation der Massnahmen von einem «Unbehagen» in der Bevölkerung, auf welches der Bundesrat eine Antwort gebe.
Die Regierung zieht damit die Lehren aus dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative. Bald steht eine weitere Abstimmung über die Personenfreizügigkeit an, jene zur Begrenzungsinitiative der SVP. Diesmal will der Bundesrat im Abstimmungskampf etwas Konkretes in der Hand haben.
Dem Ansatz zum Durchbruch verholfen hat Justizministerin Karin Keller-Sutter, die für die Begrenzungsinitiative zuständig ist. Die Analysen zur Masseneinwanderungsinitiative hätten gezeigt, dass viele ältere Personen aus Furcht vor Verdrängung aus dem Arbeitsmarkt Ja gestimmt hätten, erklärte sie. Das müsse der Bundesrat berücksichtigen.
Im Parlament schuf sich Keller-Sutter damit nicht nur Freunde. Dass manche ihr am Mittwoch bei der Gesamterneuerungswahl des Bundesrates die Stimme verweigerten, wurde auch mit ihrem Einsatz für die neue Sozialleistung erklärt.
Im Ständerat gibt es grundsätzlichen Widerstand gegen die Überbrückungsleistungen (ÜL): Eine Kommissionsminderheit aus SVP- und CVP-Vertretern beantragt dem Rat, nicht auf die Gesetzesvorlage einzutreten.
Sie erkenne angesichts des bereits gut ausgebauten Netzes der sozialen Sicherheit keinen Bedarf für die neue Leistung, argumentiert die Minderheit. Zudem befürchtet sie, dass für Arbeitgeber ein Anreiz geschaffen würde, ältere Arbeitnehmende zu entlassen.
Die Gegnerinnen und Gegner führen auch die Kosten ins Feld. Der Bundesrat geht davon aus, dass nach der Einführungsphase etwa 4400 Personen jährlich Anspruch auf Überbrückungsleistungen haben.
Die Kosten für den Bund belaufen sich demnach auf 30 Millionen Franken im Jahr 2021, steigen in den Folgejahren und betragen ab 2030 rund 230 Millionen Franken im Jahr. Dem stünden Einsparungen bei den Ergänzungsleistungen von zu Beginn 20 Millionen und später mehr als 30 Millionen Franken pro Jahr gegenüber, schrieb der Bundesrat in der Botschaft ans Parlament.
Anspruch auf Überbrückungsleistungen hätten Personen, die mit 58 Jahren oder später ihre Stelle verloren und während der Dauer der Arbeitslosenentschädigung keine neue gefunden haben. Voraussetzung ist, dass sie mindestens 20 Jahre lang mit einem Erwerbseinkommen von mindestens 75 Prozent der maximalen AHV-Rente in die AHV eingezahlt haben.
Damit will der Bundesrat eine Einwanderung ins System verhindern. Weiter muss in den 15 Jahren unmittelbar vor der Aussteuerung während mindestens 10 Jahren ein minimales Erwerbseinkommen von 21'330 Franken erzielt worden sein.
Anspruch hat ausserdem nur, wer weniger als 100'000 Franken Vermögen hat. Bei Ehepaaren liegt die Schwelle bei 200'000 Franken. Selbstbewohntes Wohneigentum soll bei der Vermögensschwelle nicht angerechnet werden.
Die Überbrückungsleistung wird gleich berechnet werden wie eine Ergänzungsleistung. Ihre Höhe entspricht der Differenz zwischen den anerkannten Ausgaben und den anrechenbaren Einnahmen. Allerdings ist der Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf um 25 Prozent höher. Damit würden auch Krankheitskosten abgegolten, die bei den EL gesondert vergütet würden.
Ausserdem sollen die ÜL plafoniert werden, damit die Betroffenen weiterhin einen Anreiz haben, sich um eine Stelle zu bemühen. Die Rente betrüge maximal das Dreifache des Betrags für den allgemeinen Lebensbedarf bei den EL. Das sind für alleinstehende Personen aktuell 58'350 Franken und für Ehepaare 87'525 Franken.
Die Sozialkommission des Ständerates ist im Wesentlichen den Anträgen des Bundesrates gefolgt. Zusätzlich will sie allerdings im Gesetz verankern, dass Bezüger von Überbrückungsleistungen ihre Bemühungen zur Integration in den Arbeitsmarkt jährlich nachweisen müssen.
Anders als der Bundesrat will sie Überbrückungsleistungen ausserdem nicht von der Steuer zu befreien. Und sie will den Bundesrat beauftragen, dem Parlament nach vier Jahren Bericht über die Umsetzung zu erstatten. Nach acht Jahren soll der Bundesrat dem Parlament über die Wirksamkeit Bericht erstatten und einen Antrag für das weitere Vorgehen stellen.

